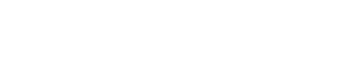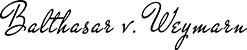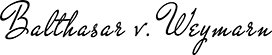Dies ist nach „Year Of The Cat“ der zweite Songtext, der mir als Beispiel für die Kunst vielschichtigen Erzählens in der Musik aufgefallen ist:
ABBA — „Don’t Shut Me Down“, produziert 2021 von Benny Andersson.
Ich nehme an, den kennen die meisten unter den Lesern: zusammen mit einem zweiten Titel war dies das „Comeback“ des gemischten Quartetts aus Schweden vor vier Jahren; mit Spannung erwartet von den Fans wie von der Presse, die zwischen der Erwartung „endlich wieder skandinavische Magie“ und „werde die sich blamieren?“ hin- und her-oszillierten.
Was soll denn daran so vielschichtig sein? Sieht doch sehr geradeheraus aus — eine Frau zögert davor, bei ihrem Ex-Lover an der Wohnungstür zu klopfen, weil sie nicht weiß, ob sie willkommen ist, und ob er (wäre da nicht ein „him“ im Prolog, könnte es auch ein gleichgeschlechtliches Ex-Paar sein) ihrem Ansinnen, sich die Sache mit der Trennung nochmal zu überlegen, positiv gegenübersteht. Ende.
Immerhin ist der Song ein Ohrwurm, und die unverhohlene Ähnlichkeit der Musik mit Abbas 80er-Jahre-Melodien wie „One Of Us“ oder dem 70er Trennungsopus „Knowing Me Knowing You“ hat sicher dabei geholfen, seit 2021 über 30 Mio. Aufrufe allein auf Youtube zu generieren. Und bei dem einen oder anderen genaueren Hinhören fallen dann einige Dinge auf:
- Die Ähnlichkeit zu „One Of Us“ ist nicht nur musikalisch mit der prominenten Bassline und dem entspannten Backbeat, der Harfe im Hintergrund. Das Lied könnte auch inhaltlich ein Sequel sein: eine Frau vermisst ihren Partner und hat Zweifel, ob ihr Auszug vor einiger Zeit nicht ein Fehler war — und ein paar Jahre später wartet sie nicht mehr am Telefon, sondern bringt den Mut auf, bei ihm anzuklopfen.
- Geht es wirklich nur darum, oder könnte es auch um die Gefühle der Band gehen, nach 40 Jahren wieder „vor die Fans“ zu treten? Neben dem klassischen Arrangement zitiert sich Benny selbst mit zwei Piano-Gimmicks aus „Dancing Queen“ — dem Glissando ganz zu Beginn, das kurz vor dem Drop auftaucht, und den absteigenden Doppelakkorden im zweiten Refrain.
- Oder geht es um die „Abbatare“ der Londoner Show? Einige Hinweise wären zu finden … nicht nur die IT-Begriffe wie „shut me down“, „reloaded“, „decoded“, sondern auch „the shape and form I appear now“ oder „I’m now and then combined“ deuten darauf hin: gebt uns eine Chance, schaut mal hin, auch so eine Hi-Tech-Variante kann funktionieren.
Und dann, irgendwann, vielleicht beim 20. Hören, singt man einmal den falschen Text mit, und dann, schlagartig, versteht man, um welche Art diabolischen Meisterwerks es sich bei „Don’t Shut Me Down“ handelt. Es wird einem klar, dass der Prolog zur Melodie des Refrains gesungen wird, und wenn dieser Groschen gefallen ist, kann man gar nicht fassen, dass einem das nicht gleich aufgefallen war. Der Effekt beim ersten Hören ist folgerichtig: wenn der Refrain zu hören ist, klingt er sofort vertraut, und zwar nicht deswegen, weil es ja die Harmonien von Frida und Agnetha sind, sondern weil man die Melodie ja ganz zu Anfang schon einmal gehört hat.
Zur Vielschichtigkeit und Langlebigkeit der Wirkung tragen weitere kompositorische Kniffe bei: die Melodielinie wechselt zwischen Moll- und Durharmonien, und das sozusagen falsch herum. Vermeintlich fröhliche Zeilen klingen aber traurig, und andersherum. Der Refrain — meistens der Teil eines Popsongs, der die meiste Zeit einnimmt — ertönt nur zwei Mal, und damit im absoluten Minimum, um überhaupt Refrain genannt werden zu „dürfen“. Statt mehrerer Wiederholungen folgt sofort nach dem 2. Refrain der Epilog, der eine Zeile aus der 1. Strophe aufgreift und der das Lied völlig offen enden lässt. Bis zum Schluss bleibt die Spannung unaufgelöst, was denn der Ex-Lover davon hält, dass seine Ex unangemeldet in der Tür steht.
Und weil man sich gern mit Dingen beschäftigt, die einem noch nicht gleich zum Ohr heraushängen, wird man neugierig auf die Details. Mit großer Ökonomie hat Texter Björn Ulvaeus mit Worten das Tableau der Geschichte gemalt, das auf Erinnerungen, die in vertrauten Räumen an Streits der Vergangenheit hochkommen, hinausläuft. All das reicht aus, um mit nur wenigen Worten in wenigen Zeilen das lebendige Bild einer schwedischen Stadtlandschaft mit Wohnhäusern, Kinderspielplätzen, Holzbänken und kaltem Abendwind zu zeichnen. Diese Art „Ökonomie der Worte“ teilen gute Songtexte mit Lyrik. Eine Leserin (oder ein Hörer), die sich an diese sparsame Ausdrucksform gewöhnt hat, fängt an, aufmerksamer wahrzunehmen.
Ein Geheimnis vielschichtigen Erzählens ist, nicht zu viel zu erzählen.