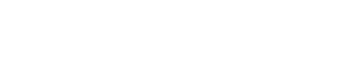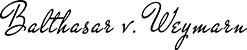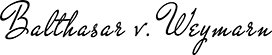Aus einer Laune heraus beginne ich mal eine lockere Artikelreihe über vielschichtiges Erzählen. Das Erzählen auf mehreren Ebenen steht Drehbuchautoren im Allgemeinen ja gut an, jedenfalls wenn ihnen daran liegt, dass ihr Publikum sich das dann entstandene Filmwerk nicht nur 1x anschauen möchten. Darüber zu schreiben, ist aber nicht leicht, weil hier Aspekte ins Spiel kommen, die nur unzureichend durch Worte beschrieben werden können.
Aber ich versuche es mal.
Zuschauer dazu zu ermutigen, auf mehreren Ebenen wahrzunehmen, ist die Voraussetzung. Erst dann werden sie assoziieren wollen. Die Kunstform, in der das intuitiv geschieht, ist die Lyrik. Niemand erwartet, dass ein Gedicht nur das bedeutet, was zu lesen ist. Die Kunstform, die auch diese Art „sofortige Mehrschichtenwahrnehmung“ auslösen kann, sind Lieder.
Und weil wir hier ja nicht in einem Anfängerkurs sind, nehme ich ein Meisterwerk für vielschichtiges, aber zugängliches Songwriting:
Al Stewarts „Year Of The Cat“, produziert 1976 von Alan Parsons.
On a morning from a Bogart movie
In a country where they turn back time
You go strolling through the crowd like Peter Lorre
Contemplating a crime
She comes out of the sun in a silk dress running
Like a watercolor in the rain
Don’t bother asking for explanations
She’ll just tell you that she came
In the year of the cat
She doesn’t give you time for questions
As she locks up your arm in hers
And you follow ‚till your sense of which direction
Completely disappears
By the blue tiled walls near the market stalls
There’s a hidden door she leads you to
These days, she says, I feel my life
Just like a river running through
The year of the cat
While she looks at you so cooly
And her eyes shine like the moon in the sea
She comes in incense and patchouli
So you take her, to find what’s waiting inside
The year of the cat
Well morning comes and you’re still with her
And the bus and the tourists are gone
And you’ve thrown away your choice you’ve lost your ticket
So you have to stay on
But the drum-beat strains of the night remain
In the rhythm of the newborn day
You know sometime you’re bound to leave her
But for now you’re going to stay
In the year of the cat
Auf Webseiten wie songmeanings.com sind eine Menge Interpretationen zu lesen. Einige davon drehen sich um den längere Instrumentalbreak vor der letzten Strophe; und es ist sicherlich nicht falsch, in der Reihenfolge der Instrumente, der Spannung und dem Anspannung/Entspannungs-Wechsel die musikalische Entsprechung eines Sexualakts zu lesen. Wenn Sie sich auf den Song einlassen und mitnehmen lassen durch die üppige Instrumentation und breitwandige Produktion des Liedes, entstehen schnell kinoartige Bilder eines Sommers z.B. in Marokko, reiche Farben, exotische Gerüche, unterschwellige aber verführerische Ahnungen von Gefahr. Und die Versuchung ist groß, es dabei zu belassen; anzunehmen, dass es um eine lakonische Beobachtung einer vergangenen Episode geht, die der Erzähler des Liedes sich selbst in der Du-Form zu erinnern gibt.
Aber — was wäre wenn …
… es bei dem Lied eigentlich um die Metaebene geht? Der Titel „Year Of The Cat“ beziehungsweise der weibliche Hauptcharakter repräsentiert ein Lied, das sich jemand anhört. Es ist nur dann präsent, während es zu hören ist. Der Song kommt zum Hörer und hängt sich ein, nimmt einen mit an unbekannte Orte und zu seinem Geheimnis („By the blue tiled walls near the market stalls / There’s a hidden door she leads you to“). In der Instrumentalsektion „feiert“ der Song die Einheit, die zwischen Song und Zuhörer entstanden ist. Und in der letzten Strophe ist sich das Lied dessen bewusst, dass es enden wird, will aber nicht loslassen und schreibt sich in die Gehörgänge ein, so dass man es nicht vergisst („for now you’re going to stay / in the year of the cat“).
Als mir diese Idee kam, erinnerte ich mich an „Die Unendliche Geschichte“, das magnum opus von Michael Ende, das auch auf mehreren Ebenen funktioniert, aber vom Autor bewusst als Geschichte über die Magie des Geschichtenerzählens geschrieben wurde. Dass diese tiefere und eigentliche Ebene nicht mit großen roten Buchstaben auf die Oberfläche der Geschichte gemalt ist, zeigt die Kunst des Autors. Beim ersten Lesen war mir vage bewusst, dass es etwas Tieferes in der Geschichte geben musste, aber was das war, erschloss sich mir damals nicht gleich. Erst Jahre später fiel mir die geniale Dreiteilung der Leseperspektive auf: Ich, der Leser, lese die Geschichte eines Jungen, der eine Geschichte liest. Der Groschen fiel, als ich über Phantásien als Faerie nachdachte, das „Feenreich“ oder Reich der Phantasie im Menschen, über das auch J.R.R. Tolkien in seinem richtungsweisenden Aufsatz „Über Märchen“ philosophiert hatte: Bastian tritt über das Buch in seine eigene Phantasie ein. Ohne es zu wissen, wird er nach dem Wasser des Lebens suchen, um es am Ende des Buches seinem Vater zu bringen.
Die Magie, die durch diese mehreren Ebenen entsteht, wird den wenigsten Lesern, Hörern und Zuschauern bewusst sein. Aber sie wirkt. Das Fehlen dieser zweiten Ebene in den Verfilmungen der „Unendlichen Geschichte“ mag der Grund sein, weswegen die Zuschauer, die das Buch gelesen hatten, am ehesten vom Film enttäuscht waren. Ihnen fehlte die Ebene unter der Oberfläche.
Im einem zweiten Teil werde ich versuchen, dem Geheimnis einen weiteren Schritt näherzukommen.